Seit nunmehr 15 Jahren veröffentlicht De Gruyter geisteswissenschaftliche Publikationen im Open Access. Wie hat sich der Markt in der Zeit verändert und wo sehen Sie den Verlag diesbezüglich in 10 Jahren?
Als ich 2012 im Lektorat von De Gruyter anfing, hatten wir gerade die ersten Open-Access-Bücher veröffentlicht und bereiteten gerade die Gründung unserer ersten Open-Access-Zeitschrift in der Linguistik vor. Zu dieser Zeit erschien weniger als eine Handvoll unserer geistes- und sozialwissenschaftlichen Neuerscheinungen OA und das blieb auch über einige Jahre so. Ich erinnere mich noch gut daran, wie aufregend es war, in dieser Phase ein Open-Access-Buch zu betreuen. Die Standards für das Impressum und die Vertragsgestaltung waren noch nicht etabliert, und das Verständnis für Creative Commons-Lizenzen zum Beispiel war nicht so weit verbreitet wie heute.
Ab 2017/2018 begann das Open-Access-Buchprogramm sich stärker und schneller zu entwickeln, aufgrund einer sich langsam, aber stetig erweiternden Förderlandschaft für Monografien und zunehmender Empfehlungen und Mandate, Open Access zu publizieren. Dies führte zu einer steigenden Nachfrage von Autorinnen und Autoren nach diesem Publikationsmodell. Bei De Gruyter veröffentlichen wir mittlerweile deutlich über 200 Neuerscheinungen im Jahr im Open Access. In einigen Fachbereichen entspricht dies mittlerweile mehr als einem Viertel aller Buchpublikationen eines Jahres. Diese Entwicklung ist natürlich fantastisch, bei genauerer Betrachtung wird jedoch deutlich, dass viele dieser OA-Publikationen aus gut ausgestatteten und in häufigen Fällen mit OA-Mandaten ausgestatteten Drittmittelprojekten wie beispielsweise ERC-Projekten oder DFG-Sonderforschungsbereichen stammen.
Trotz der sehr begrüßenswerten Etablierung von OA-Monografienfonds an deutschen Universitäten ist es immer noch so, dass auch in Deutschland der Zugang zu OA-Publikationsmitteln begrenzt ist. Wir freuen uns, dass wir zumindest für einige Fachbereiche durch unsere „Transformationspakete“ eine konsortiale Finanzierung von Open-Access-Publikationen etablieren konnten. Dies ermöglicht es Autorinnen und Autoren ohne OA-Finanzierungsmöglichkeit, diesen Weg der Publikation zu wählen.
Wo werden wir in 10 Jahren stehen? Im Zeitschriftenbereich sehen wir gerade, wie herausfordernd es ist, die Open-Access-Transformation für ein überwiegend geistes- und sozialwissenschaftliches Portfolio voranzutreiben und nachhaltig sowie global zu gestalten – im Einklang mit den Publikations- und Fachkulturen. Dieser Weg ist lang, und im Buchbereich wird er sogar noch länger sein. Daher denke ich, dass wir auch in zehn Jahren in einer Realität leben werden, in der verschiedene Publikationswege und -formate nebeneinander existieren werden.
Im September haben Sie bekannt geben, dass sie die OA-Transformation im Zeitschriftenbereich bis 2028 realisieren und mit Subscribe to Open gestalten wollen. Was sind die Beweggründe dafür? Und welche Erfahrungen haben Sie mit dem Modell bisher gemacht?
Wir begannen 2018/2019, uns damit zu beschäftigen, wie wir unsere Subskriptionszeitschriften in den Open Access überführen konnten. Gut 70% unseres Portfolios sind geistes- und sozialwissenschaftliche Zeitschriften, von denen viele im 19. Jahrhundert im Zuge der Ausdifferenzierung der Wissenschaften entstanden sind. Wir schlossen erste Transformationsverträge, so genannte Publish- und Read-Abkommen, insbesondere im europäischen Ausland ab. Dadurch ermöglichten wir, Autorinnen und Autoren der teilnehmenden Einrichtungen Open Access zu publizieren.
In Deutschland, wo Springer und Wiley bereits nationale Transformationsverträge hatten, gestaltete sich die Suche nach einem passenden Modell für uns als sehr herausfordernd. Das lag vor allem daran, dass unsere Autoren- und Vertriebsstrukturen nicht übereinstimmten. Unser Ziel war es, unsere lang etablierte Allianzlizenz für die Geistes- und Sozialwissenschaften mit einer soliden Open-Access-Komponente auszustatten. Dabei mussten wir das wirtschaftliche Risiko in einem vertretbaren Rahmen halten und einen Weg finden, der den Publikationskulturen und Finanzierungsstrukturen geistes- und sozialwissenschaftlicher Periodika gerecht wurde.
Die Erfahrung zeigte, dass APC-basierte Zeitschriften in den Geistes- und Sozialwissenschaften nicht funktionierten. Um 2015 hatten wir einige solcher Zeitschriften gegründet und über mehrere Jahre versucht, diese zu etablieren - leider ohne sichtbaren Erfolg. Wir waren uns bewusst, dass insbesondere in den Geisteswissenschaften der Anteil von Publikationen, die nicht im klassischen Sinne Forschungsartikel waren, erheblich war. Diese sogenannten "non-research-Artikel" waren jedoch nicht förderfähig im Rahmen von APC.
2020/2021 begannen wir parallel, uns mit Subscribe to Open (S2O) zu beschäftigen, einem Modell, das vom US-amerikanischen Verlag Annual Reviews entwickelt wurde. S2O ermöglicht die jahrgangsweise Überführung von Zeitschriften in den Open Access, ohne Publikationsgebühren zu erheben. Gemeinsam mit dem Nationalen Open-Access-Kontaktpunkt und dem Herausgebergremium der Zeitschrift "Bibliothek Forschung und Praxis" starteten wir einen Piloten, den wir im Rahmen des HSS-Konsortiums in den Jahren 2022 und 2023 erfolgreich auf 16 Zeitschriften ausweiteten.
Diese Entwicklung bedeutete jedoch auch, dass wir als Verlag nun zwei verschiedene Transformationsansätze, also S2O und Publish & Read, verfolgten. Und dies war neben der zunehmenden wissenschaftspolitischen Dynamik Anlass, uns über ein Jahr sehr intensiv damit auseinanderzusetzen, wie die Transformation für unsere Periodika gelingen kann. Dabei analysierten wir die Strukturen unserer Autorschaft, unseres Portfolios und unserer Vertriebsmärkte. Wir führten Gespräche mit Bibliotheken und Forschungsförderern und werteten unser S2O-Pilotprogramm aus.
So sind wir zum Schluss gekommen, dass S2O das Modell ist, dass es ermöglicht, relativ zügig, also in den nächsten fünf Jahren, 270 Subskriptionszeitschriften sukzessive in den Open Access zu überführen, ohne in die bestehenden Publikationskulturen und -praxen der Zeitschriften einzugreifen und allen Autorinnen und Autoren, also unabhängig von Herkunft und Mittelausstattung, die Open-Access-Publikation zu ermöglichen und damit die Sichtbarkeit und Zugänglichkeit ihrer Forschung zu erhöhen. Erste Auswertungen unserer S2O-Pilotzeitschriften zeigen, dass sich die Nutzung im ersten S2O-Jahr im Vergleich zu den Vorjahren hinter der Bezahlschranke um das 6-fache erhöht hat. S2O ermöglicht somit genau das, was seit jeher die Kernaufgabe des Verlags ist: Die bestmögliche Verbreitung der von uns veröffentlichten Werke zu gewährleisten und Reichweite zu schaffen.
De Gruyter ist einer der führenden Verlage für Open-Access weltweit und arbeitet auch eng mit Forschungsförderern zusammen, um Open Access in der Wissenschaft zu etablieren. Was würden Sie aus dieser Perspektive sagen sind die größten Herausforderungen in der Finanzierung von Open Access?
In den vorherigen Antworten wurde bereits deutlich, dass ein egalitärer Zugang zu Open-Access-Publikationen von großer Bedeutung ist und wissenschaftsethisch geboten ist. Es besteht die Gefahr, dass der Abbau der Zugriffsbeschränkungen auf wissenschaftliche Literatur neue Hürden in den Publikationsmöglichkeiten schafft, dass die Paywall to Access durch eine Paywall to Publish ersetzt wird. Und dieser Thematik wird aktuell und zu Recht viel Aufmerksamkeit geschenkt.
Aus meiner Perspektive stellt eine der Herausforderungen bei der Finanzierung von Open Access dar, dass diese national, regional oder lokal organisiert und aufgesetzt wird, während die wissenschaftliche Forschung und Kommunikation global ist. In dieser Spannung zwischen global agierender Wissenschaft und notwendigerweise national oder lokal gestalteten Förderrichtlinien und Finanzierungslogiken entstehen dann das, was ich hier als "unintended consequences" bezeichnen möchte.
Ein Beispiel aus dem Buchbereich verdeutlicht dies: Ein Beitrag eines Sammelbandes entsteht im Rahmen eines Drittmittelprojektes der Autorin. Sie hat die Auflage oder zumindest die Empfehlung, alle Forschungsergebnisse, die aus dem Drittmittelprojekt resultieren, im Open Access zu publizieren, und es stehen dafür auch Mittel zur Verfügung, ihr Kapitel im Sammelband OA zu publizieren. Dies führt dazu, dass hybride Sammelbände entstehen, in denen einzelne Beiträge hinter einer Bezahlschranke stehen, während andere frei zugänglich sind. Aus meiner Sicht ist dies keine sinnvolle Publikationsform. Der Forschungsförderer hat zwar sein Ziel erreicht, dass alle Ergebnisse der von ihm geförderten Projekte frei zugänglich sind, fördert jedoch gleichzeitig gemischte Publikationsformate, die nicht wünschens- und erstrebenswert wert sind.
Gerade deshalb ist es so wichtig, dass Wissenschaft, Forschungsförderung, Bibliotheken, Intermediäre und Verlage gemeinsam über die Ausgestaltung der Open-Access-Transformation beraten, wie es in der ENABLE Community geschieht.
Weitere Informationen:
Dr. Christina Lembrecht
Senior Manager Open Research Strategy
eMail: christina.lembrecht@degruyter.com
Offene, community-geleitete Infrastrukturen für Metadaten-Management, Dissemination & Archivierung
Hiermit laden wir Sie und Euch herzlich ein zu unserem ersten ENABLE!-Werkstattgespräch im neuen Jahr: Am 11.01.24 von 16:00 Uhr bis 17:30 Uhr widmen wir uns der Fragestellung, wie Open-Access-Bücher besser in bestehende Nachweissysteme und Verbreitungskanäle integriert werden können.
Eine Lösung dafür ist Thoth Open Metadata, entwickelt vom COPIM-Projekt. Thoth ist eine Plattform zur Erstellung, Verwaltung und Verbreitung von Metadaten, die speziell darauf zugeschnitten ist, die Probleme bei der Einbindung von Open-Access-Werken in die Buchlieferkette zu lösen. Die Plattform bietet Verleger*innen ein Tool, mit dem sie alle für die Verbreitung von Büchern erforderlichen Metadaten erfassen können, z. B. Informationen zu Titeln, Autor*innen, Veröffentlichungsdaten usw., sowie Metadaten, die speziell für digitale und Open-Access-Bücher gelten, z. B. dauerhafte Identifier für Produkte, Dateiadressen sowie Mitwirkende und deren institutionelle Zugehörigkeit. Thoth ermöglicht die weite Verbreitung dieser Datensätze, indem es sie in eine Vielzahl von branchenüblichen und vertriebsspezifischen Metadatenformaten umwandelt und alle Datensätze unter einer CC-0-Lizenz über offene APIs zugänglich macht. Somit können diese automatisiert in die etablierten Vertriebskanäle aber auch Nachweissysteme wie Bibliothekskataloge oder Repositorien übernommen werden.
Datum: 11.01.2024
Uhrzeit: 16:00 - 17:30 Uhr
Eine Anmeldung für die Werkstatt ist nicht erforderlich. Sie können/Ihr könnt über den folgenden Link teilnehmen:
https://uni-due.zoom.us/j/61895247098
Meeting-ID: 618 9524 7098
Kenncode: 871185
Wir freuen uns sehr auf Ihre/Eure Teilnahme!
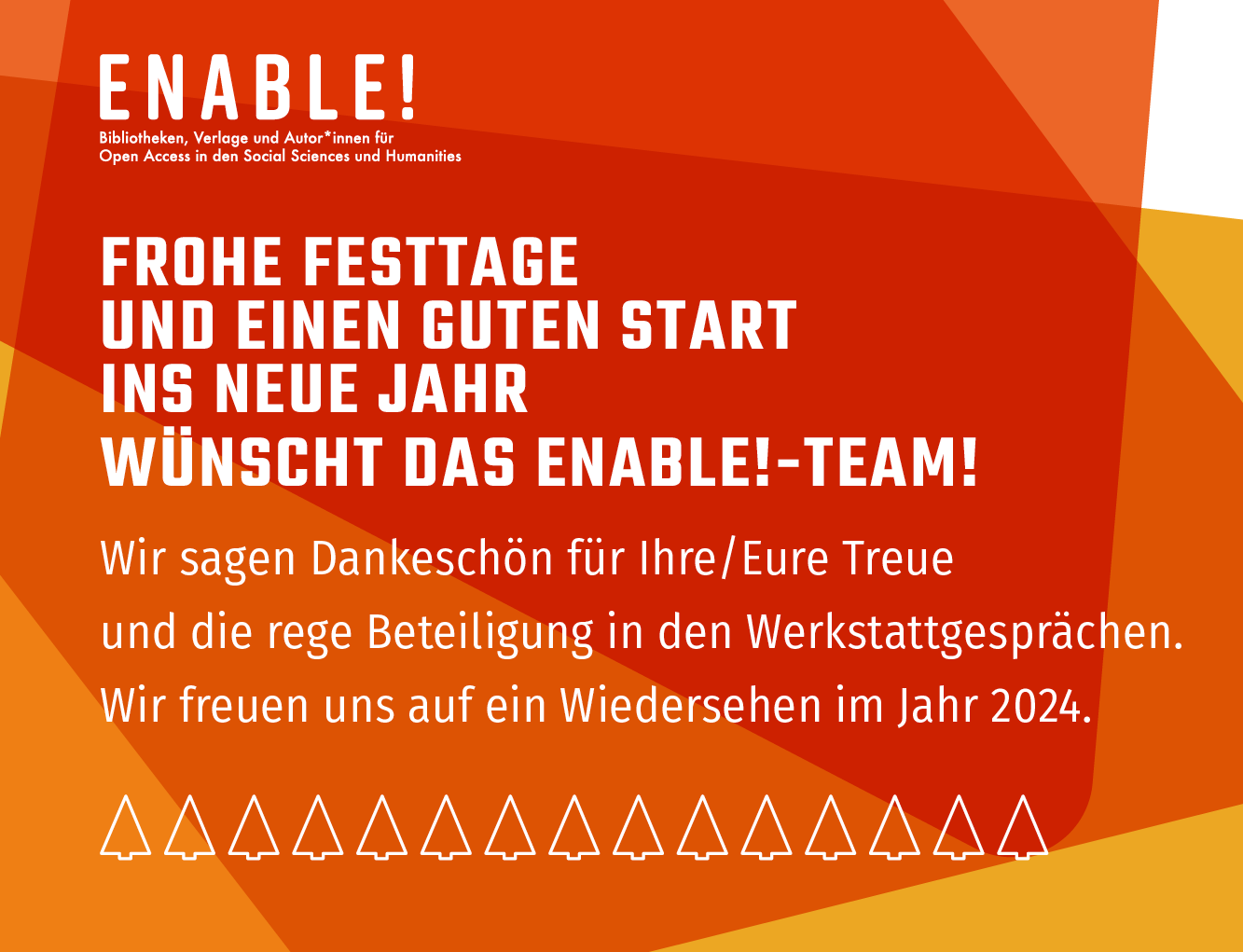
Liebe ENABLE!-Community,
dieses Jahr war von personellen Veränderungen, aber auch großen Schritten in der Fortführung der OA-Transformation geprägt. Wir konnten mit Diane Korneli-Dreier die Händlerperspektive ins Steuerungsgremium aufnehmen. Die ebenfalls gewonnene Melanie Völker vom Waxmann Verlag muss das Steuerungsgremium leider zum Ende des Jahres aus zeitlichen Gründen wieder verlassen. Wir suchen daher ab 2024 ein weiteres Mitglied aus der Verlagswelt als ihre Nachfolge. Alexandra Jobmann ist aus der Elternzeit zurück und hat ihre Aufgaben von Kathrin Popp wieder übernommen, der wir hiermit noch einmal ganz herzlich Danke! für die Unterstützung sagen möchten.
Diane hat in diesem Jahr auf der BiblioCon ein Community-Treffen initiiert und organisiert. Ein solches Get-together werden wir 2024 gern in Hamburg wiederholen.
Ein Highlight des Jahres 2023 war die Gründung eines Arbeitskreises, bestehend aus Mitgliedern der ENABLE!-Community & der GeSIG zur Erarbeitung möglicher Finanzierungs- und Organisationsmodelle für Open-Access-Bücher. Wir sind gespannt auf die nächsten Schritte!
Den zweimonatlichen Turnus der Werkstattgespräche behalten wir auch im kommenden Jahr bei und laden Sie und Euch schon mal ganz herzlich zum ersten Termin am 11. Januar 2024 ein! Das Thema wird Metadatendissemination sein.
Wir freuen uns auf ein gutes neues Open-Access-Jahr 2024!
Mit den besten Grüßen und Wünschen aus dem ENABLE!-Steuerungsgremium
Agathe Gebert
Dorothee Graf
Alexandra Jobmann
Diane Korneli-Dreier
Kathrin Popp (bis 09/2023)
Melanie Völker (bis 12/2023)
Karin Werner
Welche Ziele innerhalb der Open-Access Transformation wurden in der Schweiz schon erreicht? Welche formulierten Ziele gibt es in der Schweiz?
In der Schweiz gibt es eine gut vernetzte OA Szene, u.a. durch den Arbeitskreis Open Access. Alle Universitäten haben Repositorien aufgebaut. Viele haben Publikationsdienste mit der Software OJS und OMP für Zeitschriften und Bücher eingerichtet. Für Gold OA Publikationen stehen vielen Forschenden neben den nationalen Förderungen durch den Schweizer Forschungsfürderer SNF an ihren Universitäten und Hochschulen Fördermöglichkeiten zur Verfügung.
Seit 2018 gibt es in der Schweiz eine nationale Open Access Strategie, die vorsieht, dass bis 2024 für Publikationen Schweizer Forschender hundert Prozent OA erzielt werden soll. Davon sind wir aber weit entfernt. Zudem wurden Verhandlungen mit den großen Verlagen mandatiert, die nun zum Teil neu verhandelt werden. Aktuell wird die Strategie revidiert. Neu werden insbesondere Bibliodiversität, bzw. Berücksichtigung der Diversität der Publikationslandschaft für verschiedene Fächer, Bücher und Diamond OA besonders hervorgehoben.
Was sind aus Ihrer Sicht die größten Hürden in der Open-Access-Transformation?
Hürden gibt es viele, weil sich viele Faktoren gleichzeitig ändern müssen, wie etwa der Geldfluss, die Beteiligung von Forschenden, die Frage der Kostentransparenz, aber auch die gleichmäßige Förderung von Open Access für unterschiedliche Publikationsförderung.
ENABLE! bietet den Raum für Austausch und Vernetzung aller Stakeholdern unserer Branche. Welche Beweggründe hatten Sie sich ENABLE! anzuschließen?
Es ist eine Seltenheit, dass sich die Stakeholder der gesamten Lieferkette zusammensetzen und bezüglich einer zukunftsträchtigen Einbettung von Open Access in den Bestandsaufbau zusammenarbeiten.
Dieses Projekt ragt daher aus den vielen Open Access-Förderungsprojekten heraus. Es wird spannend sein zu sehen, welche Erfahrungen aus Deutschland auch in der Schweiz umsetzbar sein werden.
Welche Rolle spielt Open Access an der UB Basel und wie sind Ihre Erwartungen für die kommenden 5 Jahre?
Die UB Basel unterstützt alle verschiedenen OA Facetten mit Services, Infrastrukturen und finanzieller Förderung, dazu zählen Grün, Gold, Hybrid und Diamond. Die UB Basel ist auch an R&P Agreements beteiligt.
Insgesamt ist Open Science ein wichtiger Bestandteil der strategischen Ausrichtung der UB Basel. Der Wunsch von Forschenden, gute Unterstützung für OA zu bekommen, ist stets vorhanden. In den kommenden 5 Jahren wird uns die Verlagerung zu Open Access auch auf dem Buchmarkt beschäftigen.
Wir hoffen, dass wir mit der Beteiligung am Projekt ENABLE! einen Schritt in diese Richtung machen können!
Weitere Informationen:
Dr. David Tréfás
Leiter Moderne Sammlungen an der Universitätsbibliothek Basel
eMail: david.trefas@unibas.ch
Herausforderungen und Lösungsansätze
Hiermit laden wir Sie und Euch herzlich ein zu unserem nächsten ENABLE!-Werkstattgespräch: Am 09.11.23 von 16:00 Uhr bis 17:30 Uhr widmen wir uns der Fragestellung, wie scholar-led Open-Access-Zeitschriften organisiert und für die Zukunft aufgestellt werden können.
Nachdem wir in der letzten Werkstatt ausführlich über Möglichkeiten der Finanzierung diskutiert haben, sollen in dieser Werkstatt Organisations- und Administrationsaspekte im Vordergrund stehen. Dazu haben wir den Herausgeber und Autor*innen des Dokuments "Wissenschaftsgeleitetes Publizieren. Sechs Handreichungen mit Praxistipps und Perspektiven" eingeladen, um mit uns gemeinsam über technische Abläufe, Tools und Infrastrukturen, Urheberrecht, Qualitätssicherung, Organisation und Prozessgestaltung sowie gute Governance von OA-Zeitschriften zu sprechen.
Diskussionsteilnehmer*innen sind:
- Marcel Wrzesinski (Herausgeber der Handreichung und Projektleitung "Scholar-led Plus" + Thema: Urheberrecht & Datenschutz)
- Evin Dalkilic (Themen: Arbeitsabläufe & Workflows sowie Governance & Rechtsform)
- Doreen Siegfried (Thema: Kommunikation & Distribution)
- Antonia Schrader (Thema: Technik & Infrastrukturen)
Da der Fokus auf einem lebendigen Austausch mit Ihnen und unseren Gästen liegt, bitten wir darum, die Handreichungen im Vorfeld zu lesen.
Datum: 09.11.2023
Uhrzeit: 16:00 - 17:30 Uhr
Eine Anmeldung für die Werkstatt ist nicht erforderlich. Sie können/Ihr könnt über den folgenden Link teilnehmen:
https://uni-due.zoom.us/j/61895247098
Meeting-ID: 618 9524 7098
Kenncode: 871185
Wir freuen uns sehr auf Ihre/Eure Teilnahme!
Open Access wird zunehmend als Aufgabe für alle Stakeholder der Wissenschaft verstanden. Wie verstehen Sie die Rolle der Hochschulbibliotheken in dem Prozess der OA-Transformation?
Die Hochschulbibliotheken nehmen bereits vielfältige Aufgaben wahr. So sind sie oft die zentrale Anlaufstelle für Information und die Servicedienstleistungen für Ihre Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in allen Fragen rund um das Thema Open Access. Dies betrifft sowohl die individuelle Beratung der Autoren mit Blick auf geeignete OA-Journale und die OA-Policy der Verlage als auch die verschiedenen Fördermöglichkeiten von Artikeln und Büchern innerhalb der Hochschule und weiterer Förderprogramme.
Darüber hinaus verwalten sie die Open Access Fonds inklusive Rechnungsbearbeitung, leisten ein differenziertes Monitoring mit Blick auf Publikationsvolumen und Kostenentwicklung und werden zukünftig auch die zentrale Anlaufstelle für das ganzheitliche Informationsbudget ihrer Hochschule. Zusätzlich engagieren sich einige von ihnen beim Aufbau alternativer, nichtkommerzieller OA-Transformationsstrukturen insbesondere in den Fachgebieten, in denen das kommerzielle Interesse an Open Access bislang weniger stark ausgeprägt war.
Sie selbst sind ja in diesem Prozess engagiert. Welche Aufgaben sehen Sie in diesem Zusammenhang als zentral an?
Die zentrale Aufgabe ist der Aufbau und vor allem die Etablierung finanziell tragfähiger Open Access-Strukturen, die ihrerseits innerhalb der Wissenschaften von den Autoren akzeptiert werden. Für die Produzenten (Autoren) bedeutet dies vor allem eine Übernahme der Kosten durch die eigene Institution bzw. Forschungsförderer. Dies wird allerdings ohne eine grundlegende Reform der Finanzierung der Hochschulen und einer Verlagerung von Mittelzuweisungen hin zu den publikationsstarken Einrichtungen nicht funktionieren.
Problematisch ist die Finanzierung allerdings in jenen Fächern der Geistes- und Sozialwissenschaften, die weniger stark von Drittmitteln profitieren. Hier ist ein Umstieg auf Open Access sehr oft abhängig vom Einzelfall und der Aufnahme entsprechender Titel in Crwodfundingprojekte. Für deren Realisierung ist mittelfristig eine Verlagerung weg von einem meist zufällig zustande kommenden Crowdfunding hin zu einer strukturellen Einbindung derartiger Initiativen in die Informationsbudgets der jeweiligen Hochschule anzustreben.
Dies würde auch die Planungssicherheit der beteiligten Verlage erhöhen Auf der anderen Seite gilt auch für Open Access Publikationen derselbe wissenschaftliche Qualitätsanspruch wie für Kaufpublikationen, um Akzeptanz innerhalb der Community zu erreichen.
Wo stehen wir Ihrer Meinung nach heute bei dem Prozess der OA-Transformation wissenschaftlicher Inhalte?
Aus einer einstmals durch viel Idealismus getragenen Bewegung ist mittlerweile, insbesondere im STM-Bereich ein lukratives Geschäftsmodell geworden. Zwar haben sich dabei einige neue Verlage und Journals etabliert, doch ist augenfällig, dass es besonders die großen, international agierenden Wissenschaftsverlage sind, die das Geschäft mit Open Access zunehmend dominieren, ohne sich gleichzeitig aus dem anscheinend immer noch lukrativen Subskriptionsgeschäft zurückzuziehen. Auch erscheinen immer mehr Anbieter auf der Bildfläche, die sich mit dubiosen Geschäftsmodellen und qualitativ unzureichenden Journals die Idee des Open Access für das schnelle Geld zunutze machen wollen.
Leider kommt der ursprünglich intendierte flächendeckende Wechsel der Subskriptionszeitschriften, angeschoben durch die DEAL-Verträge, praktisch nicht in Gang. Auf der anderen Seite erscheint mir in Deutschland ein Umstieg auf Open Access in den Geistes- und Sozialwissenschaften eher erfolgversprechend, zumal in vielen Fällen für Zeitschriften und Bücher sich die Nachfrage nach deren Inhalten primär auf den deutschsprachigen und europäischen Markt konzentriert.
Die nächsten Jahre werden zeigen, ob sich Open Access langfristig durchsetzen wird. Entscheidend dafür ist aber ein flächendeckendes Aufgreifen von Open Access in Nordamerika und Asien.
Weitere Informationen:
Dr. Rainer Plappert
Universitätsbibliothek der FAU Erlangen-Nürnberg
eMail: rainer.plappert@fau.de